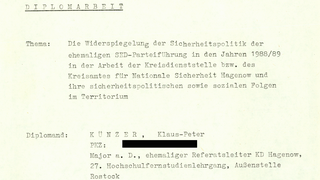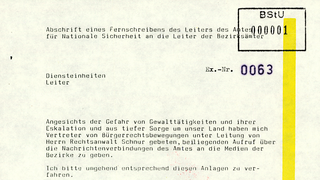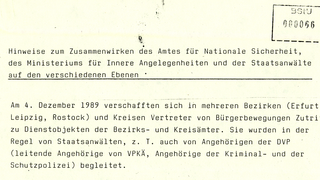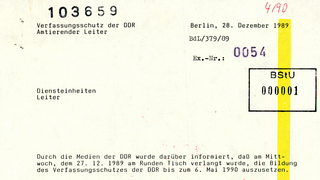Der Zentrale Runde Tisch
Im Vormonat November war es zu einschneidenden Veränderungen gekommen: die Grenzöffnung, das Ende der Unterdrückung von Demonstrationen und Protestversammlungen, eine gesellschaftliche Debatte über die Krise und der Wechsel zu einer Koalitionsregierung, auf die der SED-Apparat nur noch begrenzten Einfluss hatte. Faktisch wurde die DDR nun nicht mehr von einer Parteidiktatur beherrscht, sondern war in eine Phase der Liberalisierung eingetreten. Aber es gab noch eine Fülle offener Probleme: Obwohl sich Regierung und Volkskammer von der Unterordnung unter die SED zu emanzipieren suchten, litten sie dennoch an einem unheilbaren Legitimitätsdefizit: Sie waren nicht aus freien Wahlen hervorgegangen. Die nationale Frage war in Folge der Maueröffnung erneut aktuell geworden, der politische und der wirtschaftliche Charakter des künftigen Systems war umstritten.
Im Dezember 1989 kam es zum Übergang von der Liberalisierung des Regimes zur Doppelherrschaft: Am Zentralen Runden Tisch (und vielen Runden Tischen in den Bezirken) verhandelten nun die Kräfte des Alten Regimes mit Vertreterinnen und Vertretern der Bürgerbewegung über die Auflösung der Parteidiktatur. Vor allem der politische Protest auf der Straße richtete sich mehr gegen das bereits abgetretene Regime als gegen das neue Kabinett Modrow, aber die Abrechnung mit den früheren Machthabern destabilisierte auch die Übergangsregierung.
Wesentlichen Anteil hatte daran eine Institution, die plötzlich zu Leben erwacht war: die Volkskammer. In ihrer Sitzung am 1. Dezember wurde die "führende Rolle" der SED "mit übergroßer Mehrheit" (also auch mit den Stimmen der SED-Abgeordneten) aus der Verfassung gestrichen. Für die politische Atmosphäre im Lande aber war noch wichtiger, dass ein Untersuchungsausschuss zu Amtsmissbrauch und Korruption einen ersten Bericht erstattete. Es ging um persönliche Bereicherung der alten Spitzengenossen (Erich Honecker, Günter Mittag, Harry Tisch usw.) und ihrer Familien auf Kosten der Staatskasse. Das wurde zu einem gewaltigen Skandal. Gerade diejenigen, die dem System bisher noch die Treue gehalten hatten, darunter viele SED-Mitglieder, waren fast am Boden zerstört.
Wenige Tage später wurden die ersten SED-Spitzenfunktionäre verhaftet. Am 3. Dezember tagte das SED-Zentralkomitee ein letztes Mal. Das Politbüro und das Zentralkomitee erklärten ihren Rücktritt. Die Leitung der Partei wurde einem provisorischen "Arbeitsausschuss" übertragen, dem niemand mehr aus der alten Führungsriege angehörte.
Für die Staatssicherheit war diese Entwicklung aus mehreren Gründen fatal:
- Sie war in die Korruption des Alten Regimes verwickelt, vor allem durch den Bereich Kommerzielle Koordinierung (KoKo), zuständig für die Beschaffung von Devisen und Westwaren für die Politbürokratie.
- Ihr neuer Amtsleiter, Wolfgang Schwanitz, machte in der Volkskammertagung eine ziemlich unglückliche Figur, weil er behauptete, von all dem nichts gewusst zu haben.
- Der Chef der KoKo, Alexander Schalck-Golodkowski, zugleich Staatssekretär und MfS-Oberst, war von den Abgeordneten heftig kritisiert worden und sollte vor den Untersuchungsausschuss geladen werden. Für ihn war das Anlass in den Westen zu fliehen.
- Seine Flucht wiederum war ein Auslöser dafür, dass Demonstranten und Aktivisten aus der Bürgerbewegung nun dazu übergingen, Kreisdienststellen und Bezirksverwaltungen der Staatssicherheit zu besetzen.
- Und schließlich vertiefte diese Entwicklung die innere Krise der Staatssicherheit.

Sitzung des Zentralen Runden Tisches im Dietrich-Bonhoeffer-Haus am 6. Dezember 1989
Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1207-026, Klaus Oberst